
Die Frau ist selbst schuld, wenn sie so einen kurzen Rock anzieht und die Lippen rot macht! Also, natürlich nicht Schuld an einer Vergewaltigung, aber mit so einer Aufmachung sendet sie schon Signale aus! Wenn eine Frau einen kurzen Rock anzieht, dann heißt das doch, dass sie angemacht werden will. Sie macht sich doch hübsch – für die Männer. Und dann darf sie sich nicht beschweren, wenn ein Mann auch mal das Aussehen kommentiert!
Im Blick von Beobachtern
Das Zitat ist fiktiv und künstlich verdichtet. Aber es bringt ganz gut die Aussagen über eine verbreitete Ansicht auf den Punkt, wer denn Schuld habe, wenn sexistische Bemerkungen fallen. Ich möchte mich heute aber nicht an der Schuldfrage abarbeiten, sondern erklären, wieso von außen als „sexy“ wahrgenommene Kleidung unter Umständen vollkommen anders intendiert ist.
Statt hier eine Einführung in die Definition der
Rape Culture
zu geben (was
andere an anderer Stelle
viel
schöner
tun als ich), möchte ich Einblicke geben, warum ich mich anziehe, wie ich mich anziehe. Warum ich an manchen Tagen einen Minirock aus dem Schrank hole. Was das mit der Kultur zu tun hat, mit Zeichen und Codes. Und wieso das rein gar nichts damit zu tun hat, dass ich gern objektifiziert, bewertet oder sexistisch kommentiert werden würde.
Konstruktion eines Erscheinungsbildes
Jeden Morgen erfinde ich mich neu. Mit dem Griff in den Kleiderschrank wähle ich ein Äußeres für den Tag. Dieses Äußere, für das ich mich entscheide, korrespondiert mit meinem Inneren. Es gibt Tage, an denen ich mich um nichts in der Welt in eine enge Jeans zwängen würde. Und solche, an denen es nichts passenderes gibt. Zur Kleidung gesellt sich das Make-up als weitere Ausdrucksform. Mein „Schmink-Standardprogramm“ wechselt häufig. Und, klar, auch das Make-up ist nicht alleine ein Versuch, „hübsch“ auszusehen und damit eine Aussage darüber,
was genau
ich persönlich als hübsch definiere, an welchem Schönheitsideal ich mich orientiere. Es ist für mich ebenso Spiegel meiner Persönlichkeit und meiner Befindlichkeit wie meine Kleidung. Wenn ich also nach langer Zeit von Jeans und Nur-Lidstrich zu flatterndem Rock wechsle, die Haare wieder offen trage und einen knallroten Lippenstift auflege, dann will ich damit die Botschaft ändern, die ich nach außen sende.
Codes im sozialen Kontext
Bei dieser Selbst-Konstruktion bediene ich mich kulturell verankerter
Codes
. Ich verwende Bilder,
Meme
,
Tropen
, die im mir bekannten Kulturkontext existieren, um Aussagen über mich zu treffen. Ich stelle mit Hilfe von
Zeichen
Verbindungen her zwischen mir und dem Objekt, auf das ich referenzieren will. Ein einfaches Beispiel sind Cowboystiefel. Zieht sich ein Mensch Cowboystiefel an, weckt er*sie damit Assoziationen an Western, an Amerika, an Goldgräber*innen, Revolverheld*innen und so weiter.
Anders formuliert könnte man auch sagen: Ich lasse mich von diesen Assoziationen inspirieren. Mal ist es ein Foto in einer Zeitschrift, mal eine Frau, die ich auf der Straße sehe. Manchmal fasziniert mich die Kleidung einer Protagonist*in in einem Film, mit der ich mich identifizieren kann, und manchmal historische Persönlichkeiten. Solche Codes sind sehr praktisch, denn sie kommunizieren stark verdichtete Informationen zwischen Menschen, die sie verstehen. Aber das ist nicht immer der Fall. Stellen wir uns vor, ein Alien besuchte die Erde und sähe die Cowboystiefel aus unserem Beispiel. Was würde es sehen? Vermutlich die Funktion: ein fußumhüllendes Kleidungsstück aus stabilem Material, das vor dem direkten Kontakt mit dem Untergrund schützt. Das dürfte es dann gewesen sein. Mit den Details, die Cowboystiefel zu Cowboystiefeln machen – wadenhoch, oben etwas weiter, die Spitze ausgeprägt aber nicht spitz, kleiner Absatz, Schnalle – könnte es nichts anfangen. Denn diese Details übermitteln kulturell geprägte Botschaften, die einen Empfänger brauchen, der sie decodieren kann. Beim Decodieren passieren zwei Dinge: Menschen, die die Codes kennen, verstehen die Botschaft implizit, also z.B. „Langer, geschwungener Lidstrich und roter Lippenstift: Könnte eine 60s-Anleihe sein, vielleicht mag sie das aktuelle 60s-Musik-Revival oder Mad Men“.
Neben dem Inhalt der Botschaft wird aber auch klar, dass
überhaupt
ein gemeinsamer kultureller Hintergrund besteht, der das Lesen des Codes erst ermöglicht, was so ein
Ingroup-Gefühl
herstellt. Damit birgt die Verwendung von bestimmten Codes neben der Ausdrucksmöglichkeit zusätzlich die Chance, sich selbst einer Gruppe mit bestimmten Interessen und Werten zuzuordnen.
Um ein Beispiel zu nennen: Eines meiner Kleider lässt mich ein wenig wie eine Priesterin im antiken Griechenland aussehen, ein zweites Kleid erinnert eher an eine Hippie. Funktional betrachtet unterscheiden sie sich kaum: Sie sind beide lang, beide aus Baumwolle, und beide nur für sehr warmes Wetter geeignet. Vielleicht bin ich heute besonders alternativ-öko-groovy drauf und will das auch zeigen. Welches Kleidungsstück ich wähle, hängt also nicht allein von funktionalen Aspekten ab, sondern davon, wie ich mich fühle, wie ich mich darstellen möchte. Ich bediene mich der Codes, um Hinweise darauf zu geben, wie ich meine Position in der Gesellschaft sehe, wie meine Stimmung heute ist oder wie ich wahrgenommen werden will. Wähle ich also das Hippie-Kleid, bin ich auf jeden Fall unbeschwerter, lockerer, grooviger unterwegs als in meinem Priesterin-der-Athene-Outfit.
Aber Menschen, die die Codes nicht kennen, verstehen nichts.
Encodieren, decodieren
Zusammengefasst bediene ich mich also kulturell verankerter Codes, um Botschaften auszusenden. Das tut jede*r von uns, wenn auch in unterschiedlichem Maße, in verschieden starker Reflektiertheit und aus unter Umständen unterschiedlichen Quellen. Dadurch, dass nicht alle Quellen allen Menschen gleich zugänglich oder gleich präsent sind, stelle ich entweder eine Ingroup-Beziehung zu jemandem her, der*die die Codes lesen kann – oder tue genau das nicht. Kann jemand die Codes
nicht
lesen, ist schwer zu vermeiden, dass sie – von der Outgroup –
falsch
gelesen werden. Wo ich vollkommen blind für die Bedeutung von Markenkleidung bin (sind Hosen von Adidas gerade „cooler“ als Levi’s? Bin ich mit Nike sportlicher unterwegs als mit Puma? Ist Hollister trendiger als Hilfiger?), können andere nicht auf die Kunst der griechischen Antike zugreifen.
Natürlich verändert sich die
Konnotation
auch über die Zeit. Alte Assoziationen lösen sich auf, neue kommen hinzu. War
die Jeans
am Anfang ihrer Geschichte nichts als ein robustes Kleidungsstück für Arbeiter*innen, wurde sie in den 1950ern zu einem Code für gesellschaftlichen Ungehorsam und Rebellion, gerade, indem sich die Träger*innen in die Tradition der Arbeiter*innen stellten. Heutzutage sind Jeans kaum noch revolutionär und haben sogar in den
Dresscode
Einzug gehalten.
Objektifizierung
All das überlege ich, mal mehr elaboriert, mal weniger, wenn ich mich für oder gegen Kleidung entscheide. Und, um es ganz klar zu sagen: Nein, ich überlege mir nicht, ob ich damit Männer anmache. Wozu auch? Ich bin exklusiv liiert und nicht auf der Suche. Und ich empfinde Pfiffe, derbe Sprüche und gierige Blicke auch nicht als Kompliment. Wenn ich etwas Figurbetontes trage, dann, weil ich mich gerade in meinem Körper wohl fühle. Und erst, wenn ich an unangenehme Blicke in der S-Bahn oder billige Anmachen denke, frage ich mich, ob mein Outfit zu gewagt ist, etwa mein Priesterin-der-Athene-Kleid zu durchsichtig oder mein Hippiekleid zu schulterfrei. Und meine Frage lautet dann: „Kann ich das
trotzdem
anziehen?“ und nicht: „Ich möchte das gern
deswegen
tragen!“
Teile diesen Beitrag:
-
Facebook
-
Pocket
-
Google
-
Mehr
-
Die Frau ist selbst schuld, wenn sie so einen kurzen Rock anzieht und die Lippen rot macht! Also, natürlich nicht Schuld an einer Vergewaltigung, aber mit so einer Aufmachung sendet...




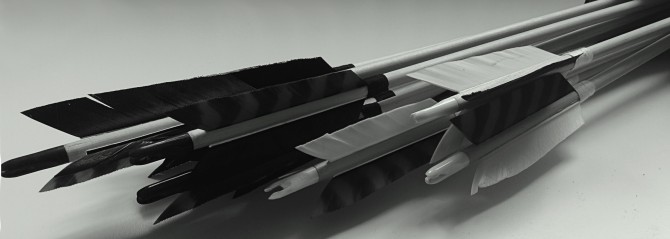
 Dieser Text ist ein Gemeinschaftswerk von Weird & Tugendfurie.
Dieser Text ist ein Gemeinschaftswerk von Weird & Tugendfurie.
